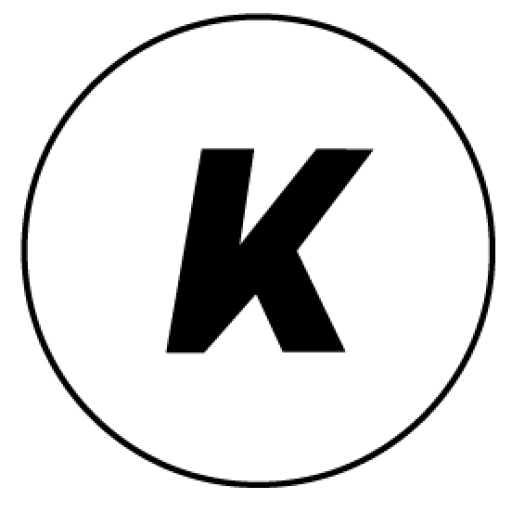
Es ist Zeit für dein kreatives Erwachen. Entdecke, wie lebendig es dich macht, etwas Kreatives zu schreiben und deine Texte mit anderen zu teilen. Als deine Mentorin begleite ich dich gerne auf deiner Schreibreise.
*Dieser Artikel ist ursprünglich erschienen auf meinem Zweitblog thirtyplus, den ich auf lange Sicht mit „Kea schreibt“ zusammenlegen möchte. Interessante Kommentare zum Artikel findest du daher unter dem Original.
Wenn ich überlege, welche Geschichten mich zeit meines Lebens am meisten berühren konnten, dann waren es wohl diejenigen, die von Menschen erzählen, die sich voll und ganz ihrer Kunst oder einer Idee verschrieben haben. Die auf Konventionen pfiffen und das taten, was ihnen unmöglich war, nicht zu tun. Die den Mut hatten, ihre eigene Sicht auf das Leben zu entwickeln. Frida Kahlo, Amanda Palmer, Lou Andreas Salomé, Marina Abramovic, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Clara Immerwahr – um ein paar Beispiele herauszugreifen. Sie alle hatten etwas gemeinsam: Radikalität. Sie ließen sich auf die Möglichkeit ein, zu scheitern, aber sie taten es trotzdem. Sie glaubten an etwas, das ihr inneres Leuchtfeuer war, das sie anzog, magnetisch, wie die Motten das Licht. Da gab es etwas in Ihnen, das Wahrhaftigkeit beanspruchte, das verwirklicht werden wollte.
Diesen Traum der eigenen Wahrheit leben nur wenige und nur wenige wagen es überhaupt, ihn wirklich zu träumen. Ich bin da keine Ausnahme.
Eigentlich wusste ich immer, wozu ich tauge. Ich wollte Schriftstellerin sein. Weiter kam ich in meinem Denken lange Zeit nicht, denn die Zweifel waren turmhoch, die Ängste ebenso. „Davon kann ja keiner leben“. Mehr gab es dazu nicht zu sagen. Ich weiß nicht, warum ich begann, das zu glauben. Aber ich tat es. Und während ich Grafikerin wurde und lernte, Geld zu erwirtschaften, statt nährender Gedanken, um dieses Geld dann wieder für Konsumgüter auszugeben, die die innere Leere füllen sollten, zirkulierten in meinem Kopf unablässig diese Fragen:
Wäre ich in anderen Zeiten eine Künstlerin geworden? Hätte ich den Mut gehabt, radikal zu sein, was ich bin? Ist es zu spät, umzukehren? Gibt es überhaupt ein „zu spät“?
Aber ich stellte sie mir im Stillen, diese Fragen, fühlte mich einsam und exotisch. Hielt die Fassade aufrecht und quälte mich durch die Tage. Diese Welt erschien mir leer – weil sie es war. Der Tanz um das goldene Konsumkalb machte mich immer müder. Ich wollte all die Shampoos und Pumps und Rollenbilder, die ich als Frau zu erfüllen hatte, in Bausch und Bogen aus dem Fenster werfen. Für das Leben, das mein Herz führen wollte, brauchte ich sie nicht.
Wofür also das alles?
Wieso ackerte ich mich ab für einen Standard, den ich, als einzelner Mensch, nicht einmal haben wollte? Warum passte ich mich an, an eine Gesellschaft, die von mir erwartete, mich in gewisser Weise zu kleiden, meine Freizeit zu gestalten, zu lieben und mein Leben zu führen?
Diese Regeln bedeuteten mir nichts. Ich würde sogar wagen, zu behaupten, dass sie SCHLECHTHIN nichts bedeuten. Wir haben uns nur daran gewöhnt, sie sind unser flauschig bequemer Ersatz, um nicht nach Innen schauen zu müssen. Eine Maskerade, ein einziges großes Ablenkungsmanöver.
Der amerikanische Autor Henry David Thoreau, der zwei Jahre seines Lebens damit verbrachte, in einfachen Verhältnissen in den Wäldern zu leben, schreibt:
Es ist leichter „viele Tausend Meilen weit durch Schnee und Eis, durch Sturm und Kannibalen auf einem Regierungsschiff zu segeln, als das eigene Meer zu erforschen – den Atlantischen oder Stillen Ozean der eigenen Einsamkeit.“
Eine ganze Weile lang aber traute ich mich nicht auf dieses innere, offene Meer. Geduldig lag es da, aber ich paddelte am Ufer entlang und schaute sehnsüchtig zum Horizont. Dann wurde ich 30. Und irgendwie ging in mir das Licht an. Das Leben ist nicht so lang, wie man mit zwanzig denkt.
2016 gründete ich mit meiner Kreativ-Kollegin Rebecca DIE SALONS, ein Netzwerk, das es sich zur Aufgabe macht, Frauen, die in den Bereichen Kunst, Fotografie, Literatur, Musik und Philosophie aktiv sind, zusammenzubringen, zum Gestalten zu inspirieren und ihre Werke sichtbar zu machen.
Im letzten Jahr veröffentlichte ich außerdem meinen Jugendroman Schmetterlingswinter und stellte meinen bisherigen Lifestyle-Blog hello mrs eve auf Texte und Lyrik um, ebenso meinen Account in der Welt der schönen Bilder, auf instagram. Ich wollte leben, was ich predigte. Inhalt statt Form. Ich schrieb mich für ein zweites Studium der Literaturwissenschaften und Philosophie an der Uni Frankfurt ein.
Alles richtige und wichtige Schritte. Aber noch nicht genug. Ich war immer mehr im Zwiegespräch mit dem großen Wasser in mir – und spürte, dass es mich anzog, dass es von mir Hingabe forderte.
Aber irgendetwas stand da zwischen mir und meinem „wofür ich hier bin“. Nur was?
Die Erleuchtung kam mir in Berlin. Ich hatte das Vergnügen, zu einer Lesung aus Ada Dorians Roman „betrunkene Bäume“ eingeladen worden zu sein. Im Anschluss war Zeit für eine Runde Frage und Antwort-Pingpong und Ada gewährte uns Einblicke in ihr Leben als Schriftstellerin: Ihre Nebenjobs, die sie über Wasser halten sollten, bis sie mit dem Schreiben ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte, suchte sie nach einem ganz speziellen Kriterium aus: Geld? Nein. Prestige? Eh nicht. Ada sucht sie nach der Nähe des Arbeitsplatzes zum Writer’s room Hamburg aus, dem Ort, an dem sie mit Gleichgesinnten den Austausch über ihre Schreibprojekte pflegte. Und dann sagte sie folgenden Satz:
„Ich habe mir meine Welt um das Schreiben herum gebaut.“
Diese Worte warfen ein Echo in meinen Brustraum. Gefühlt konnte ich immer noch viel zu wenig Zeit in mein Schreiben investieren. Lag das wirklich nur an der Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen? Zweifellos floss viel Energie und Kraft in meinen Broterwerb. Und er wurde mir immer quälender – wo ich mich früher über neue Aufträge noch uneingeschränkt gefreut hatte, sah ich jetzt vor allem die vielen Stunden Arbeit vor mir, die mich davon abhielten, zu lesen und zu schreiben. Immer unpassender fühlten sich alle anderen Tätigkeiten an, immer stärker musste ich mich verbiegen, um als Grafikerin meine Arbeit zu erledigen. Ich glaube, der Welt als Schreibende so viel mehr geben zu können.
Aber ich entdeckte noch etwas ganz anderes in mir, das mich hinderte: Nicht mehr oder weniger als die Frage nach dem Wert des Menschen in der Gesellschaft. Nach seiner Existenzberechtigung.
Leben bedeutet, produktiv zu sein – oder doch nicht?
Ich hatte den Effizienz-Gedanken zu sehr verinnerlicht. Wir alle haben den Kapitalismus mit der Muttermilch aufgesogen. Erst langsam und in kleinen Schritten kann ich mich davon lösen – dabei ist der Anspruch an die eigene maximale Produktivität noch so jung. Wie der Philosoph Richard David Precht in diesem Vortrag anlässlich des Deutschen Medienkongresses erläutert, ist Effizienz als „Kultur-Leitmetapher“ ein Phänomen der letzten 250 Jahre. Es ist eben keineswegs ein dem Menschen innewohnendes Bedürfnis, effizient sein zu wollen, vielmehr seien wir „darauf konditioniert“ worden.
Erhellende Gedanken zu diesem Ansatz fand ich in der Beschreibung des Seminars „Poetik des Nichtstuns“ von Dr. Sören Stange, das zu meinem großen Bedauern ein Semster vor meinem Unistart abgehalten wurde. Darin heißt es, dass das lateinische Wort „otium“ übersetzt wird mit „Muße, Ruhe von Berufstätigkeit.“ Das Wort „Arbeit“ ist im Lateinischen: „negotium„, eine Definiton ex negativo, also ein Begriff, der dadurch definiert wird, was er nicht ist oder ausschließt. In diesem Fall: Die Nicht-Ruhe von Berufstätigkeit, Nicht-Nicht-Arbeit, Un-Untätigkeit.
Untätigkeit galt also in der Antike als etwas „positiv Gegebenes, Faktisches“ – nicht nur als Pause einer fortwährenden Tätigkeit, sondern als eine Tätigkeit an sich.
Dieses Bild auf das Verhältnis von Arbeit und Nicht-Arbeit wandelte sich grundlegend zu den Zeiten Goethe und Hegels:
„Arbeit und Tätigkeit werden als existentielle Modi der schöpferischen Selbstformation neu erfunden. Man ist, was man tut. Das heißt aber auch: Wer nicht arbeitet, oder allgemeiner, tätig ist, ist im Grunde überhaupt nicht.“
Dabei sahen das längst nicht alle Philosophen so. Nietzsche bedauert die Verdrängung des Nichtstuns:
Dass seine Mitwelt von dem „Grundsatz“ regiert werde, „lieber etwas tun als nichts“, korrespondiere mit einer „jetzt überall geforderten plumpen Deutlichkeit.“ Und Adorno überlegte gar einmal: „Rien faire…, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen,…könnte an die Stelle von Prozeß, Tun, Erfüllen treten.“
Mir haben diese Zitate den geistigen, durch das Leben in der Wachstumsgesellschaft verengten, Horizont geweitet. Wieso werden junge Menschen, die sich zu Kunst, Literatur oder Musik hingezogen fühlen, zur „Vernunft“ gebracht. Braucht nicht jede Gesellschaft ihre AndersdenkerInnen? Wollen wir wirklich alle, im Wirtschaftssystem ordentlich verwertbare, Rädchen werden?
Der Kapitalismus fußt auf dem Prinzip von Wachstum. Aber wenn wir uns die Welt in ihrem Zustand anschauen, dann ist es offensichtlich, dass wir nicht nur wirtschaftliches Wachstum brauchen – sondern auch geistiges. Dann liegt auf der Hand, dass reine Pflichterfüllung allein eine Gesellschaft nicht zusammen hält.
Thoreau schreibt:
„Wenn ein Mensch einmal einen halben Tag in den Wäldern spazieren geht, weil er sie liebt, dann besteht die Gefahr, dass er als Taugenichts angesehen wird. Wenn er dagegen den ganzen Tag als Unternehmer zu bringt und diese Wälder abhackt und die Erde vorzeitig kahl werden lässt– so wird er als fleißiger und unternehmungslustiger Bürger betrachtet.“
Wir brauchen Menschen, die Zeit zum Denken haben – mehr denn je. Wir brauchen innovative Geister und mutige Ideen, wir brauchen zukunftsfähige Modelle. Deshalb halte ich es für wichtig, junge KünstlerInnen und PhilosophInnen zu fördern. Ihnen nicht das Gefühl zu geben, Flausen im Kopf zu haben, sondern genau das Richtige.
Die Zeit auf der Erde ist kurz – deshalb: seid mutig! Noch mutiger!
Beschränkt euch nicht, indem ihr glaubt, eure Steuerzahlungen wären das Wertvollste, das ihr der Gesellschaft zu geben habt. Da ist so unendlich viel mehr! Die wenigsten Menschen beklagen auf dem Sterbebett, zu wenig gearbeitet zu haben. Ganz abgesehen von der Aussicht, dass Arbeitsplätze in der Zukunft alles andere, als sicher sein werden. Höchste Zeit also, das kollektive gesellschaftliche Selbstbewusstsein von der Arbeitsleistung abzukoppeln und neue Wege zu finden. Über das bedingungslose Grundeinkommen zu diskutieren. Überhaupt, leidenschaftlich zu diskutieren, statt blind und taub zu konsumieren. Wenn ich mir große Teile der jungen deutschen Bloggerszene angucke, wird mir Angst und Bange. Denn diese Konsumlawine ist eine dead end road. Wirtschaftlich UND intellektuell.
Wenn ich daran denke, dass wir alle nur Wimpernschläge im Lauf der Zeit sind, dass wir alle nur verdammt kurz auf diesem Erdboden herumspazieren, bevor auch von uns nur noch Erinnerungen übrig sein werden, dann holt mich manchmal etwas ein, das Gefühl von Unbedeutsamkeit. Macht mein Leben wirklich einen Unterschied? Tatsache: Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich: Es fühlt sich für mich lebendiger an, mein Leben schöpferisch zu verbringen, als meine Tage dem Konsumkreislauf zu widmen. Ich will mich nicht an der Skala der Produktivität messen. Ich möchte Gedanken in die Gesellschaft streuen, die berühren, Geschichten, die inspirieren. Ich will zu Ehren der Schönheit der Schöpfung ein wortgewaltiges Ehrenfest abhalten.
Weil das vielleicht am Ende alles ist, worum es geht, bevor der Tod sein Recht verlangt: so lebendig zu sein, wie irgend möglich. Der Tod selbst ist radikal. Er ist unausweichlich, fast das einzig Unausweichliche, dem wir alle ins Auge sehen müssen. Für mich ist er deshalb auch eine Aufforderung – bevor ich ihm begegne, so radikal lebendig zu sein, wie es irgendwie geht.
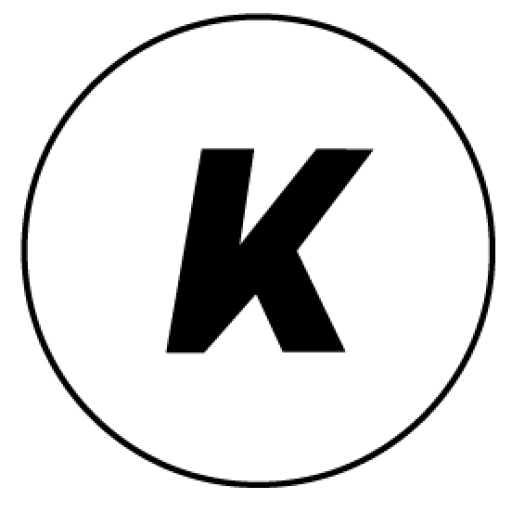
Es ist Zeit für dein kreatives Erwachen. Entdecke, wie lebendig es dich macht, etwas Kreatives zu schreiben und deine Texte mit anderen zu teilen. Als deine Mentorin begleite ich dich gerne auf deiner Schreibreise.
2 Comments
Liebe Kea,
ich habe deinen Blog erst vor kurzem entdeckt und war nun ganz erschrocken, unter diesem Eintrag keine Kommentare zu sehen, wo du doch an anderer Stelle erwähnst, wie kränkend das sein kann (aber dann habe ich mich an die Einleitung mit dem anderen Blog erinnert – Puuuh!). Es mag vielleicht unüblich sein, einen älteren Eintrag zu kommentieren, und normalerweise bin ich überhaupt sehr sparsam damit, Rückmeldungen unter Blogartikeln zu hinterlassen (weil ich nicht dachte, dass das wichtig ist für die Autoren), aber folgendes muss ich dir sagen: Ich bin gerade frisch in Elternzeit, und dieses Mal nehme ich mindestens 2Jahre (bei meiner ersten Tochter ging ich nach einem Jahr wieder arbeiten) und auf jeden Fall mache ich das auf der einen Seite für meine Kinder, aber, auf der anderen Seite auch für mich, um in dieser Auszeit zu erspüren und auch auszuprobieren, wie ich denn leben möchte, was denn in mir steckt,… Ich möchte nicht einfach machen, was man so macht, mein Leben an mir vorbei plätschern lassen, ungenutzt. Ich möchte… Was denn eigentlich? Das rauszufinden habe ich vor. Ich danke dir für die Erinnerung. Ich finde das bewundernswert und freue mich für dich, dass du weißt, was du willst: schreiben.
[…] modernen Arbeitsethik. Dabei ist dieses Modell gar nicht mal so alt. Wie ich bereits in einem Artikel über das „radikale Lebendigsein“ geschrieben habe, ist Effizienz als „Kultur-Leitmetapher“ ein recht junges Phänomen der […]